Die Liquiditätsplanung ist ein zentrales Instrument für Unternehmer:innen, um jederzeit den Überblick über die Zahlungsfähigkeit ihres Unternehmens zu bewahren. In einer Welt, in der finanzielle Engpässe oft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, hilft eine sorgfältige Planung dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. Besonders für Gründer:innen ist die Erstellung eines strukturierten Liquiditätsplans eine Herausforderung und gleichzeitig eine unverzichtbare Grundlage für das nachhaltige Wachstum ihres Geschäfts.
Unternehmen verschiedenster Branchen – vom jungen Start-up über den etablierten Mittelständler bis hin zur Filiale großer Konzerne – benötigen einen präzisen Fahrplan, der Einnahmen und Ausgaben systematisch gegenüberstellt. Die Komplexität finanzieller Bewegungen und rechtliche Anforderungen an die Buchhaltung haben dazu geführt, dass sich moderne Tools wie Lexware, DATEV, oder Debitoor als wertvolle Hilfsmittel etabliert haben. Sie erleichtern nicht nur die Erstellung eines Liquiditätsplans, sondern integrieren ihn in umfassende Finanz- und Buchhaltungssysteme.
In diesem Artikel lernen Sie detailliert, wie Sie Schritt für Schritt eine fundierte Liquiditätsplanung für Ihr Geschäft aufbauen können. Dabei betrachten wir bewährte Methoden, geben praxisnahe Tipps zur Prognose Ihrer Einnahmen und Ausgaben und zeigen Ihnen, wie Softwarelösungen wie WISO MeinBüro, sevDesk oder BuchhaltungsButler die Erstellung vereinfachen können. Auch die Bankkompatibilität, beispielsweise mit Kontist oder Commerzbank, spielt eine wichtige Rolle bei der Optimierung Ihrer Zahlungsströme.
Erfahren Sie, wie Sie typische Fallstricke vermeiden, welche Kostenpositionen besonders zu beachten sind, und wie Sie Ihre Liquiditätsplanung kontinuierlich an die Dynamik Ihres Unternehmens anpassen. So schaffen Sie nicht nur Sicherheit für Ihr Geschäftsjahr 2025, sondern auch eine belastbare Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen und Wachstumsschritte.
Grundlagen der Liquiditätsplanung im Geschäftsalltag verstehen
Die Liquiditätsplanung stellt im Kern eine detaillierte Übersicht aller zukünftigen Geldflüsse dar – sowohl der Einzahlungen als auch der Auszahlungen – und dient dazu, den Finanzstatus Ihres Unternehmens jederzeit abbilden zu können. Anders als die Gewinn- und Verlustrechnung, bei der es vor allem um den wirtschaftlichen Erfolg geht, steht hier die tatsächliche Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln im Vordergrund.
Eine sorgfältige Liquiditätsplanung gibt Auskunft darüber, ob zu jedem Zeitpunkt genug Mittel zur Verfügung stehen, um Verbindlichkeiten zu begleichen und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Besonders in den ersten drei Jahren nach der Gründung ist dies essentiell, da hier oft noch kein stabiler Cashflow existiert. Die Planung sollte deshalb idealerweise monatlich aufgestellt werden, um saisonale Schwankungen und zeitliche Unterschiede zwischen Einnahmen und Ausgaben exakt zu erfassen.
Was macht den Liquiditätsplan zum Herzstück des Finanzplans?
Der Liquiditätsplan bildet die Grundlage für weitere betriebswirtschaftliche Auswertungen, insbesondere für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Rentabilitätsrechnung. Er basiert auf realistischen Prognosen, die sowohl externe Einnahmen (z. B. Verkaufserlöse, Fördermittel) als auch interne Ausgaben (z. B. Materialkosten, Gehälter, Miete) berücksichtigen.
Dabei fungiert der Liquiditätsplan als Schnittstelle zwischen anderen Planungsinstrumenten:
- Investitionsrechnung: Zeigt an, wann größere Anschaffungen sofort zu Auszahlungen führen.
- Haushaltsplanung: Hilft, private Entnahmen und finanzielle Bedürfnisse der Unternehmer:innen einzubeziehen.
Ohne eine zuverlässige Liquiditätsplanung riskieren Unternehmen, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten, selbst wenn sie wirtschaftlich profitabel arbeiten. Im schlimmsten Fall können Liquiditätsengpässe zur Insolvenz führen, obwohl das Geschäftsmodell an sich tragfähig wäre.
Hilfsmittel für die Erstellung: Excel oder spezialisierte Software?
Grundsätzlich können Sie Ihre Liquiditätsplanung manuell, etwa mit Excel, erstellen. Das bietet den Vorteil der Flexibilität und vollständiger Kontrolle über Ihre Daten ohne Cloud-Anbindung. Allerdings erfordert die manuelle Methode ein gewisses Maß an Excel-Kenntnissen und Aufwand, insbesondere bei komplexeren Modellen oder häufigen Anpassungen.
Alternativ stehen inzwischen zahlreiche spezialisierte Programme und Online-Tools zur Auswahl, welche die Erstellung der Planung vereinfachen und häufig mit Funktionen zur automatischen Steuerberechnung, Abschreibungen und Kapitalbedarfsermittlung ausgestattet sind. Bekannte Anbieter im deutschsprachigen Raum sind beispielsweise Lexware, DATEV, Debitoor, WISO MeinBüro, sevDesk, BuchhaltungsButler, FastBill oder auch Sage.
Besonders Softwarelösungen wie Kontist oder Banking-Integrationen mit der Commerzbank ermöglichen eine automatische Synchronisation von Kontobewegungen, was die Aktualität und Genauigkeit des Liquiditätsstatus verbessert. Die Wahl der richtigen Methode sollte also auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse, Kenntnisstand und Geschäftsstruktur erfolgen.
| Art der Erstellung | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Manuell mit Excel | Hohe Flexibilität, keine Datenweitergabe an Dritte | Arbeitsaufwendig, fehleranfällig, erfordert Fachwissen |
| Software/Tools (z.B. Lexware, DATEV) | Automatisierte Berechnungen, Steuervorschläge, Schnittstellen, Zeitsparend | Kosten, evtl. Abhängigkeit von Cloud-Diensten |
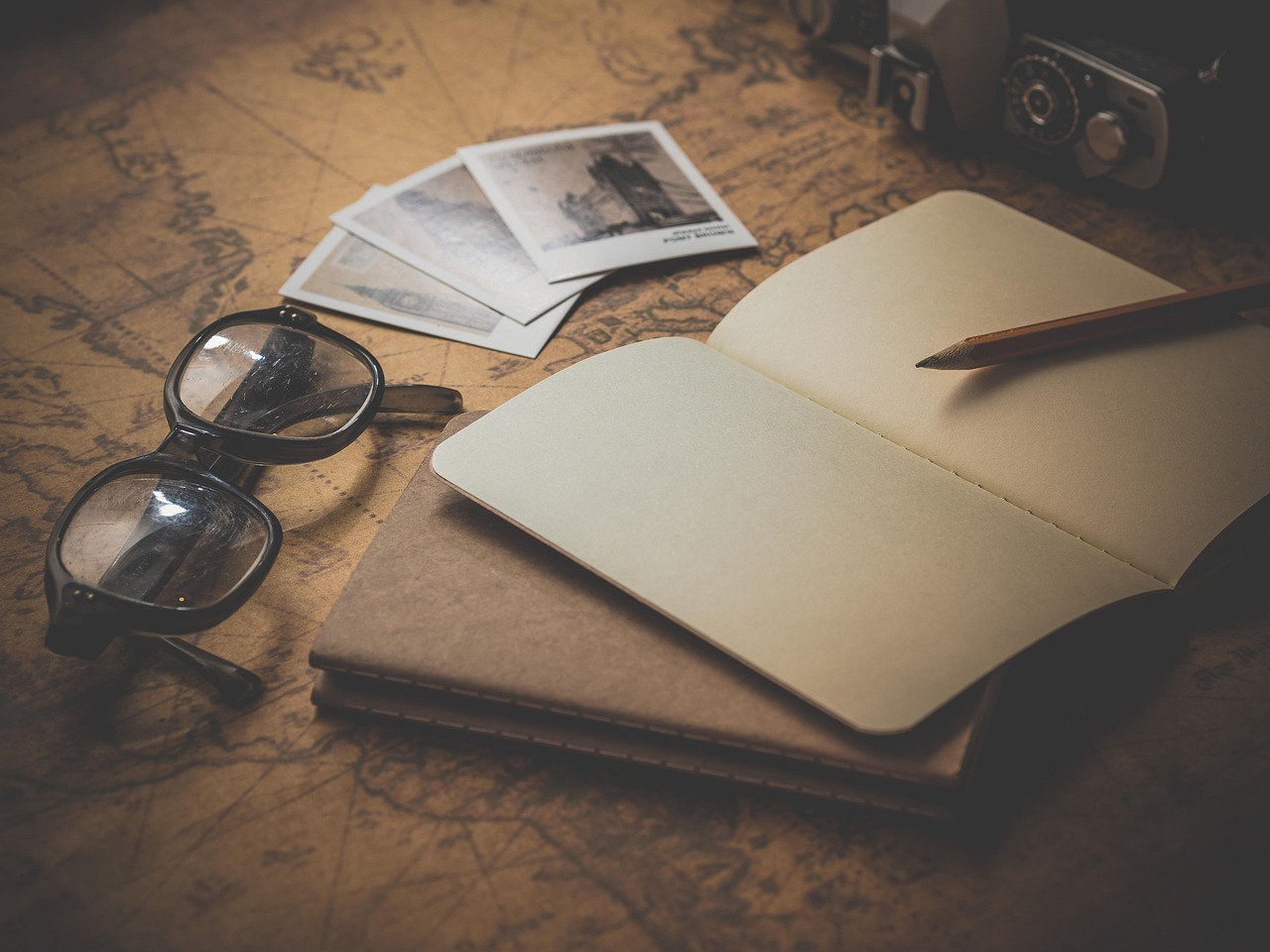
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Liquiditätsplanung für Dein Geschäft erstellen
Eine strukturierte Erstellung eines Liquiditätsplans erfolgt idealerweise in acht klar definierten Schritten. Jedes Glied in dieser Kette ist wichtig, um ein schlüssiges und belastbares Ergebnis zu erhalten. Die Praxis zeigt, dass gerade zu Beginn die richtige Gliederung und Detailtiefe entscheidend für den Erfolg ist.
1. Absatz- und Umsatzprognose erstellen
Die zentrale Frage ist: Wie viel werde ich voraussichtlich verkaufen? Dabei ist es empfehlenswert, das Angebot in verschiedene Produkte oder Dienstleistungen aufzugliedern, um die Prognose präziser zu gestalten.
Beispiel:
- Ein Blumenladen führt „Gestecke und Sträuße“ als ein Produkt zusammen, weil die einzelnen Mengen schwer zu prognostizieren sind.
- Workshops „Blumen binden“ werden als eigenständiges Produkt mit separater Mengen- und Preisprognose geführt, da sie anders kalkuliert werden.
Der Umsatz wird berechnet, indem die Absatzmengen mit dem jeweiligen Verkaufspreis multipliziert werden. Wichtig ist die Berücksichtigung von Marketingmaßnahmen, da diese den Absatz direkt beeinflussen können.
2. Material- und produktspezifische Kosten berücksichtigen
Hier definieren Sie alle direkten Kosten, die dem Produkt oder der Dienstleistung zugeordnet werden können. Dazu zählen:
- Eingekauftes Material
- Lieferkosten für einzelne Produkte
- Personal, das direkt an der Erstellung beteiligt ist
- Spritkosten bei Lieferung
Ein Beispiel verdeutlicht dies: Für ein Gesteck fallen Materialkosten von 11 Euro an, die Lieferkosten betragen 8 Euro pro Stück. Somit ergeben sich 19 Euro direkte Kosten pro verkauftem Gesteck. Kosten für allgemeine Bürokraft oder Marketing sind hier nicht berücksichtigt.
3. Gemeinkosten genau erfassen
Darunter fallen sämtliche Kosten, die den allgemeinen Geschäftsbetrieb betreffen und nicht direkt einzelnen Produkten zugeordnet werden können:
- Miete und Nebenkosten
- Personalkosten inkl. Sozialabgaben
- Marketing und Werbung
- Logistik, Lagerung und Transport
- Rechts- und Steuerberatung
- Versicherungen
- Telefon, Internet, Software, Webhosting
- Büromaterial
- Reise- und Fahrtkosten
Monatlich erfasste Gemeinkosten helfen, die Fixkostenbasis des Unternehmens zu ermitteln und Schwankungen besser zu steuern.
| Gemeinkostenposition | Monatliche Beispielkosten (€) |
|---|---|
| Miete und Nebenkosten | 1.200 |
| Personal (Büro) | 2.000 |
| Marketing | 500 |
| Versicherungen | 150 |
| IT- und Telekommunikation | 200 |
4. Investitionen als Auszahlungen erfassen
Investitionen wie Computer, Maschinen oder Fahrzeuganschaffungen wirken sich sofort auf die Liquidität aus, auch wenn sie in der Gewinn- und Verlustrechnung über mehrere Jahre abgeschrieben werden.
Beispiel:
- Anschaffung eines Rechners für 1.200 Euro brutto im April; dieser Betrag wird sofort als Ausgabe im Liquiditätsplan vermerkt.
- Kauf eines Lieferfahrzeugs für 25.000 Euro im Dezember; kein Abschreibungsanteil, sondern der gesamte Betrag wird als Auszahlung aufgeführt.
5. Geldzu- und -abflüsse separat planen
Weitere Geldbewegungen beeinflussen die Liquidität, etwa durch:
- Kreditaufnahmen
- Tilgungen und Zinszahlungen
- Gründungszuschüsse
- Privateinlagen und Privatentnahmen
Diese Positionen können sich im Lauf des Jahres ändern und werden daher häufig in Abstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung nachgetragen, sobald die Steuerabgaben klar sind.
6. Umsatzsteuer in die Planung einbeziehen
Im Gegensatz zur Gewinnrechnung werden in der Liquiditätsplanung alle Beträge inklusive Mehrwertsteuer betrachtet. Die vereinnahmte Umsatzsteuer gilt als durchlaufender Posten, der an das Finanzamt abgeführt wird, während die Vorsteuer gezahlt und erstattet wird.
- Umsatzsteuer aus Erlösen wird als Auszahlung erfasst.
- Vorsteuer aus Einkäufen wird als Geldeingang verbucht.
7. Ertragssteuern als spätere Position erfassen
Einzahlungspflichten aus Einkommensteuer, Gewerbesteuer oder Körperschaftsteuer basieren auf der Gewinnermittlung und werden in der Liquiditätsplanung berücksichtigt, wenn die entsprechenden Zahlen vorliegen.
8. Übersichtliche Zusammenfassung erstellen
Zum Abschluss fasst eine Übersichtstabelle alle Zahlen zusammen und zeigt für jeden Monat:
- Gesamtumsatz
- Gesamtauszahlungen (inkl. Investitionen und Steuern)
- Überschuss oder Unterdeckung
- Kontostand am Monatsende
Wie erstelle ich eine Liquiditätsplanung für mein Geschäft?
Bitte folgen Sie den Schritten:
- Geben Sie Ihre erwarteten monatlichen Umsätze ein.
- Tragen Sie Ihre geplanten monatlichen Ausgaben ein, inklusive Materialkosten, Gemeinkosten und Investitionen.
- Berechnen Sie automatisch Ihren monatlichen Liquiditätssaldo.
Praxisbeispiel: Liquiditätsplanung eines Blumenladens
Zur Verdeutlichung stellen wir die Liquiditätsplanung für einen fiktiven Blumenladen vor, der zwei Hauptprodukte anbietet: Gestecke und Workshops.
Der Laden prognostiziert monatlich folgende Absätze:
- 300 Gestecke und Sträuße zu einem Preis von 30 Euro pro Einheit
- 3 Workshops zu je 200 Euro pro Teilnehmer
Die Materialkosten pro Gesteck betragen 11 Euro, hinzu kommen Lieferkosten von 8 Euro. Für Workshops werden kalkulatorische Personalkosten von 400 Euro pro Monat berücksichtigt. Zusätzlich fallen monatlich 1.200 Euro Miete, 2.000 Euro Personalkosten und 500 Euro Marketingkosten an.
| Monat | Umsatz (€) | Materialkosten (€) | Gemeinkosten (€) | Investitionen (€) | Liquiditätsüberschuss (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.400 | 5.700 | 3.700 | 0 | 2.000 |
| Februar | 11.400 | 5.700 | 3.700 | 0 | 2.000 |
| März | 11.400 | 5.700 | 3.700 | 1.200 | 800 |
Dieses einfache Beispiel zeigt, wie sich trotz hoher Fixkosten am Monatsende positive Cashflows ergeben können. Die Berücksichtigung von Steuern, Kreditaufnahme oder privaten Entnahmen würde das Modell noch vielschichtiger machen, weshalb Software-Tools wie FastBill oder BuchhaltungsButler oft hilfreich sind, um den Überblick zu behalten.

Tipps für eine erfolgreiche Liquiditätsplanung in Deinem Unternehmen
Eine realistische Liquiditätsplanung lebt von realistischen Prognosen und einer regelmäßigen Aktualisierung der Zahlen. Nur so kann sie zum effektiven Steuerungsinstrument werden.
- Regelmäßig aktualisieren: Monatliche Anpassungen berücksichtigen neue Informationen und Veränderungen im Geschäft.
- Mit Puffer rechnen: Finanzielle Reserven schaffen, um unerwartete Kosten abzudecken.
- Softwarelösungen nutzen: Tools wie Lexware, DATEV oder sevDesk helfen, Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.
- Kredite und Fördermittel planen: Frühzeitig mit Banken wie der Commerzbank Kontakt aufnehmen und Möglichkeiten für Gründerzuschüsse prüfen.
- Private Ausgaben trennen: Haushaltsplan erstellen, um Unternehmens- und Privatfinanzen klar zu differenzieren.
Die Beschäftigung mit der eigenen Liquiditätslage ermöglicht nicht nur eine optimierte Geschäftsführung, sondern sichert auch langfristig die Zahlungsfähigkeit und das Vertrauen von Partnern und Geldgebern.
Praxisnahe Antworten: Fragen rund um die Liquiditätsplanung
Wie beeinflusst der Gründungszuschuss meine Liquiditätsplanung?
Der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit wird an die Gründer:innen persönlich ausgezahlt, nicht an das Unternehmen. Trotzdem ist es sinnvoll, ihn in die Liquiditätsplanung einzubeziehen, da er private Finanzbedarfe abdeckt und somit die notwendige Privatentnahme vermindert. Oft wird daher parallel zur Unternehmensplanung eine gesonderte Übersicht geführt, die den Zuschuss und die daraus resultierende Liquidität abbildet.
Kann ich meinen Liquiditätsplan selbst erstellen oder soll ich eine Software nutzen?
Grundsätzlich ist beides möglich. Excel eignet sich für Alle, die die volle Kontrolle über ihre Daten behalten wollen und bereits Erfahrung mit Tabellenkalkulationen haben. Softwarelösungen wie Lexware, FastBill oder BuchhaltungsButler bieten hingegen automatisierte Abläufe, integrierte Steuerberechnungen und Schnittstellen zur Buchhaltung, was die Erstellung erleichtert und Fehler vermeidet.
Wie oft sollte ich meine Liquiditätsplanung aktualisieren?
Eine monatliche Überprüfung und Anpassung ist empfehlenswert. So können Sie zeitnah auf Veränderungen reagieren und Liquiditätsengpässe vermeiden. Bei größeren Investitionen oder Änderungen im Geschäftsmodell sind auch kurzfristigere Updates angebracht.
Was unterscheidet Liquiditätsplanung von Gewinn- und Verlustrechnung?
Die Liquiditätsplanung betrachtet alle Ein- und Auszahlungen inklusive Mehrwertsteuer und zeigt den Kontostand bzw. die Zahlungsfähigkeit in Echtzeit. Die Gewinn- und Verlustrechnung hingegen berücksichtigt lediglich wirtschaftliche Erträge und Aufwendungen ohne direkten Bezug zum Zahlungszeitpunkt.
Wie kann ich Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und vermeiden?
Wichtig sind realistische Umsatzprognosen, eine genaue Erfassung aller Kosten und regelmäßige Kontrolle des Liquiditätsstatus. Zudem helfen Rücklagen, Kreditlinien und Fördermittel, kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bank, z. B. der Commerzbank, und Nutzung digitaler Konten wie bei Kontist optimiert die Liquiditätssteuerung.


